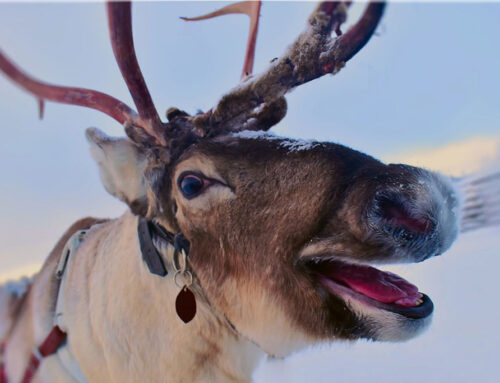Der Ahorn – ein Charakterbaum zwischen Almen, Schluchten und Parkanlagen
Seine Blätter zieren Kinderzeichnungen und das kanadische Staatswappen, seine Früchte inspirieren zum Spielen und Staunen, und seine Herbstfärbung taucht ganze Berghänge in Gold. Doch der Ahorn ist weit mehr als Dekor: Er ist Wasserhalter, Insektenmagnet, Forstpartner und Jagdbegleiter – ein echter Alleskönner mit Tiefgang, sozusagen. Ein Portrait:
DER AHORN
Name allgemein: Ahorn
(Schwerpunkt: Bergahorn – Acer pseudoplatanus)
Familie: Seifenbaumgewächse
(Sapindaceae)
Wuchshöhe:
Bergahorn 35–40 m
Alter: bis 400 Jahre
Blätter: 5-lappig, 10–20 cm groß,
graugrün unterseits, im Herbst goldgelb
Blüte: April–Mai,
in hängenden Rispen, insektenbestäubt
Früchte: Doppelachänen (Nasenzwicker),
Flugsamen
Wurzelsystem: Herzwurzler
(bergstabil und sturmfest)
Verbreitung: ganz Österreich,
Schwerpunkt Alpen und nördliche Kalkalpen
Nutzung: Möbel, Innenausbau, Drechselarbeiten
Musikinstrumente, Spielzeug,
Ökologische Rolle: insektenfreundlich,
lichtdurchlässig, strukturfördernd
Jagdliche Bedeutung: Deckungsbaum,
Fegeschäden möglich, Äsungspartner
Wie sieht der Ahorn aus?
Mit seiner markanten Blattform, der farbintensiven Herbstfärbung und seiner ökologischen Vielfalt zählt der Ahorn zu den eindrucksvollsten Laubbäumen Mitteleuropas.
Alter, Charakteristik & Wuchshöhe: Der Bergahorn wird bei günstigen Bedingungen bis zu 400 Jahre alt, wächst zügig und bildet ein ausgedehntes Herzwurzelsystem, das besonders in Hanglagen stabilisierend wirkt – eine Qualität, die ihn zum wichtigen Schutzbaum im Gebirge macht. Seine Borke ist graubraun, schuppig und plattenartig abblätternd, was ihm ein typisches, „platanenähnliches“ Erscheinungsbild verleiht. Ahornbäume zeichnen sich durch ein geradliniges Höhenwachstum und eine kräftige, meist breit ausladende Krone aus. Je nach Art erreichen sie folgende Wuchshöhen:
- Bergahorn: 30–35 m, vereinzelt auch bis 40 m
- Spitzahorn: 20–30 m
- Feldahorn: 10–15 m
Blätter, Blüten und Früchte:
Das markante, fünflappige Ahornblatt ist das Erkennungszeichen schlechthin. Beim Bergahorn ist die Blattunterseite graugrün und leicht behaart, beim Spitzahorn heller, beim Feldahorn deutlich kleiner und rundlicher gelappt.
Die Blütezeit liegt zwischen April und Mai – je nach Höhenlage. Ahornbäume sind einhäusig, das heißt: Männliche und weibliche Blüten befinden sich auf demselben Baum. Besonders der Spitzahorn lockt mit seinen duftenden, nektarreichen Blüten im Frühling zahlreiche Insekten an.
Im Spätsommer entwickeln sich die typischen geflügelten Spaltfrüchte, sogenannte Doppelachänen – im Volksmund „Nasenzwicker“. Beim Bergahorn stehen sie in einem stumpfen Winkel, beim Spitzahorn fast gerade auseinander. Sie sind eine wichtige Nahrungsquelle für Vögel, Mäuse und Eichhörnchen.
Wo kommt der Ahorn vor?
Standorte & Verbreitung: In Österreich sind insbesondere drei Arten heimisch: der Bergahorn, der Spitzahorn und der Feldahorn, wobei der Bergahorn (Acer pseudoplatanus) als größter, klimatisch robustester und waldbaulich relevantester Vertreter gilt. Alle drei Ahornarten haben unterschiedliche Vorlieben:
Bergahorn (Acer pseudoplatanus)
– Höhenlagen von 600 bis über 1.600 m
– bevorzugt kühle, frische, nährstoffreiche Böden
– dominant in den Alpen, im Wienerwald, in den steirischen Kalkalpen
Der Bergahorn ist die einzige Ahornart, die eine bedeutende Rolle in Wirtschaftswäldern und Schutzwäldern der Alpen spielt. Er ist sturm- und schneefest, lichtbedürftig, konkurrenzfähig und standortstabil.
Spitzahorn (Acer platanoides)
– in Tallagen, Auwäldern und Stadtgebieten
– wächst auch auf kalkarmen, trockeneren Böden
Feldahorn (Acer campestre)
– typischer Hecken- und Feldgehölzbaum
– eher in den Tieflagen Ostösterreichs verbreitet
Wie wird der Ahorn genutzt?
Wirtschaftliche Bedeutung und Holznutzung
Ahornholz – besonders das des Bergahorns – ist hell, feinporig, elastisch und gut zu bearbeiten. Es wird geschätzt für:
- Möbelbau, Innenausbau, Treppen, Furniere
- Musikinstrumentenbau (v. a. Geigenböden)
- Drechselarbeiten, Küchenutensilien, Kinderspielzeug
In der Forstwirtschaft dient der Bergahorn auch als Mischbaumart zur Biodiversitätssteigerung. Durch seinen raschen Jugendwuchs ist er oft in Verjüngungsflächen zu finden. Als Früh- und Mittelwuchspionier stabilisiert er Jungbestände – in Kombination mit Buche, Tanne oder Lärche.
Ökologische Rolle und
Bedeutung für die Jagd
Der Bergahorn hat zudem den Ruf, als ökologischer Brückenbauer zu fungieren. Weil …
- seine lichte Krone Strauch- und Krautschichten fördert und somit Reh- und Niederwild Versteck und Äsung bietet.
- die Rinde des jungen Bergahorns bei Nahrungsengpässen gerne geschält wird, was in Jungwäldern auch zu Wildschäden führen kann.
- seine Nektar- und Pollenproduktion Insektenvielfalt fördert, was wiederum Vögeln und Kleinsäugern zugutekommt.
In der jagdlichen Praxis werden Bergahorne gern als Deckung in Hangrevieren, als Markierungsbäume oder für Aufbruchplätze im Schatten verwendet.
Klimaresistenz und
Herausforderungen
Der Ahorn gilt allgemein als klimastabil, zeigt aber regionale Unterschiede:
- Spitzahorn leidet zunehmend unter Trockenstress und Hitze.
- Feldahorn ist hitzetolerant, dafür sturmempfindlich.
- Bergahorn verträgt Kälte und Höhenlagen gut, ist aber anfällig für die Rußrindenkrankheit (Cryptostroma corticale), die besonders in Trockenphasen auftritt und zum raschen Absterben ganzer Bäume führen kann.
Die zunehmende Sommertrockenheit in tieferen Lagen dürfte den Spitzahorn zurückdrängen – der Bergahorn bleibt in höheren Lagen jedoch weiterhin ein Hoffnungsträger für klimafitte Mischwälder.
Historisches und kulturelles Wissen
In der Volksheilkunde wurde Ahornrinde bei Magenbeschwerden und Zahnschmerzen verwendet. Das Holz galt als „Mondholz“ mit positiver Ausstrahlung – in alten Bauernhäusern wurden daraus Kinderwiegen gefertigt.
Der Ahornbaum gilt in der keltischen Symbolik als Baum der Erkenntnis und wurde in Bauerngärten gern als Schattenspender oder Hausbaum gepflanzt – insbesondere Bergahorne auf Bergbauernhöfen wurden oft über Generationen erhalten.
UNSERE
LESE-EMPFEHLUNG
Lebenszyklus Wald – vom Keimling bis zum alten Baum
Weitere Steckbriefe zu heimischen Bäumen:
Bildquellen für diesen Beitrag: © Pixabay | © iStock
Autor für diesen Beitrag: U. Macher / Jagdfakten.at
DIESEN
BEITRAG TEILEN