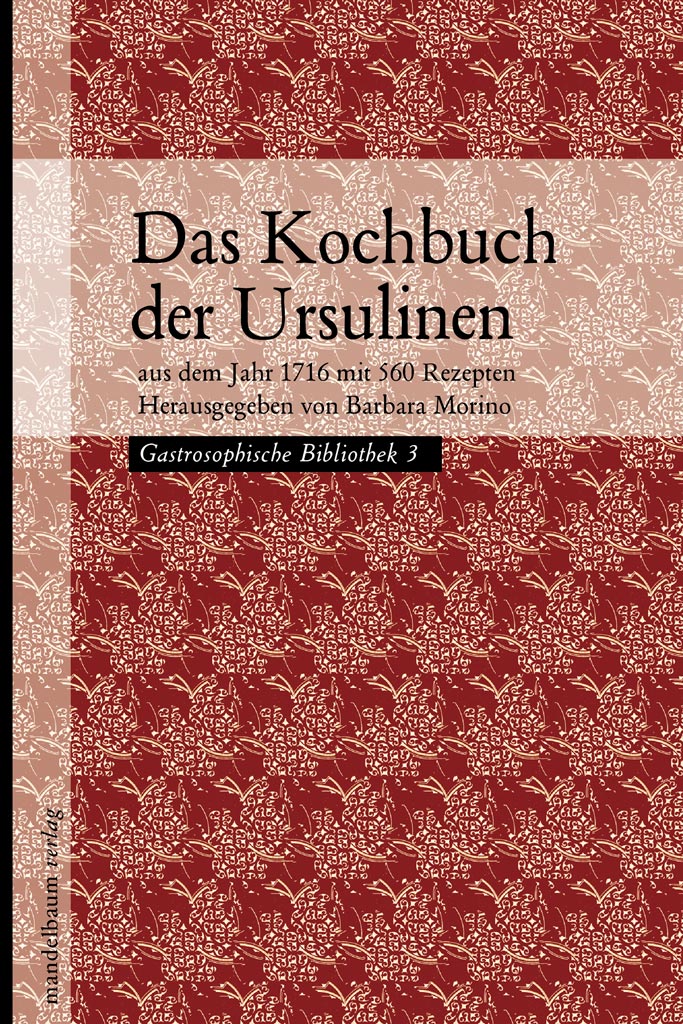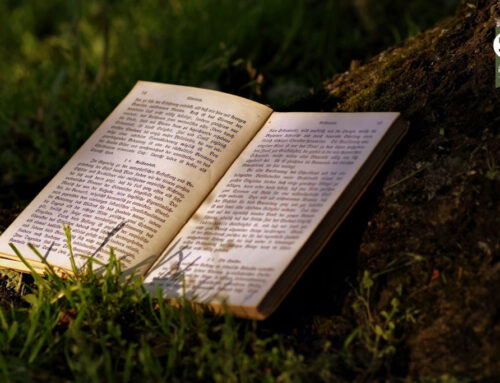„Ab in die Pfanne!“: Wie der Biber in die Küchen kam:
Mehr als nur Kirchenküche: Jahrhundertelang kam der Biber zur Fastenzeit auch in bürgerlichen Haushalten auf die Teller.
Aber warum genau – und vor allem: wie?
WIE DER BIBER
IN DIE KÜCHE KAM
Das schmeckte nicht allen, was Haubenkoch Max Stiegl da gemacht hatte. In einem Posting posierte der in Sachen Innereien überdurchschnittlich bewanderte Küchenchef des Restaurants Gut Purbach im Burgenland mit einem toten Biber. Einen, den er gleich zubereiten – und natürlich auch essen würde. „Pfui!“, sagten die einen. „Richtig und nachhaltig“, die anderen. Auffällig in dieser Debatte war die Unkenntnis über die Geschichte des Bibers in unseren Breiten. Und so viel sei verraten: Diese Geschichte ist erstaunlich kulinarisch.
Warum durfte Biber
in der Fastenzeit gegessen werden?
Warum? Weil dem Biber innerhalb der katholischen Kirche jahrhundertelang ein besonderer Platz zuteilwurde: nämlich auf den Speisekarten. Vor allem während der Fastenzeit. Die Fastenzeit bezeichnet die vierzigtägige Vorbereitung auf Ostern, in der der Verzehr von Fleisch verboten war – nicht aber jener von Fisch. Genau hier kommt eine theologische Spitzfindigkeit der Kirche ins Spiel: Der Biber lebt zwar an Land, hat aber einen schuppigen Schwanz und verbringt viel Zeit im Wasser. Also erklärten ihn die Äbte und Theologen schlichtweg zum „Fisch“.
Das war im Mittelalter nicht unüblich, weil man Tiere gerne nach ihrem Habitat kategorisierte. Kein Wunder also, dass auch andere halbaquatische Tiere wie der Otter oder das Capybara in Südamerika in diese – für die katholische Kirche durchaus genehme – Sonderkategorie fielen. So konnte man guten Gewissens die Fastenregeln einhalten und trotzdem deftig essen. Die katholischen Meinungsmacher, die den Biber als „fischartig“ bezeichneten, festigten diesen – nun ja – Glaubenssatz ab dem 12. Jahrhundert.
Bis weit ins 19. Jahrhundert hielt sich diese kulinarische Tradition in den katholischen Haushalten Europas. Dort, wo der Zugang zu Wildbret leichter war – also auf dem Land –, landete Biberfleisch und Biberschwanz öfter auf den Teller als in Städten. Aber überall galt das Biberessen – übrigens auch außerhalb der Fastenzeit, etwa wenn es gepökelt und konserviert wurde – als sozial akzeptiert. Eben gerade, weil die katholische Kirche ihren Segen gab. Wie der Biber zubereitet und verzehrt wurde, bezeugen schriftliche Quellen aus dem Mittelalter bis in die Neuzeit.
Biber für die Oberschicht
Im „Kochbuch der Ursulinen“ aus dem Jahr 1716 etwa, das am Herd des Ursulinenkloster in Salzburg nachweislich Verwendung fand, findet sich das Rezept des „Gereinigten Biberschwanz am Spieß“. Demnach wird der Biberschwanz in lauwarmem Wasser mit Gewürzen und Salz eingelegt, auf einen Spieß gesteckt und mit Butter, Zitronensaft und Zitronenschalen angebraten. Wohlgemerkt: Hier handelt es sich um ein elitäres Rezept, das den hohen sozialen – und ökonomischen – Status katholischer Klosterschwestern verdeutlicht: Vor allem Zitronen waren zu Beginn des 18. Jahrhunderts in Österreich ein rares und teures Lebensmittel, und auch Butter war – vor allem in urbanen Gebieten – das Fett der Oberschicht.
Wird in Zukunft wieder Biber gegessen?
Ein anderes Beispiel katholischer Biberkulinarik: Der „Gedämpfte Biberschwanz“ aus dem „Großen illustrierten Kochbuch“ von 1904, einem Juwel der deutschsprachigen Kochliteratur der Hauswirtschaftslehrerin Mathilde Erhardt. Der Biberschwanz wird gründlich gereinigt, in Scheiben geschnitten und sechs bis acht Stunden in einer Marinade aus Essig, „Kräutern, Lorbeerblättern und Zwiebeln“ eingelegt. Anschließend dämpft man ihn in Butter mit Zwiebeln und Wurzelgemüse. Abgelöscht wird mit Rotwein, danach kommen geriebene Semmeln hinzu. Als Letztes wird die Sauce geklärt und mit Zitronensaft abgeschmeckt.
Dass weitere Kochbücher quer durch die Jahrhunderte hindurch auch mit Rezepten jenseits des Biberschwanzes aufwarten, also im engeren Sinne auch sein Muskelfleisch verwerten, verdeutlich die eingangs erwähnte, durch und durch katholische Kategorisierung dieses Nagetiers: Der Biber wurde als Ganzes als Fisch wahrgenommen, nicht nur sein schuppiger Schwanz.
Natürlich: Biberschwanz oder gepökelte Biberkeule muss heute niemandem mehr schmecken. Auch wenn diese kulinarischen Traditionen katholischer Prägung eine Renaissance erleben könnten, weil der Biber mittlerweile nicht mehr gefährdet ist. Aber Bibergerichte als tierquälerische Flause eines Haubenkochs abzutun, verkennt die jahrhundertealte Kulturgeschichte rund um dieses Tier. Und diese ist nun mal auch kulinarisch – und wird es wohl auch wieder werden. Wenn auch mit zeitgemäßeren Rezepturen.
UNSERE
LESE-EMPFEHLUNG
Bildquellen für diesen Beitrag: © Pixabay | © Unsplash
Autor für diesen Beitrag: L. Palm / Jagdfakten.at
DIESEN
BEITRAG TEILEN