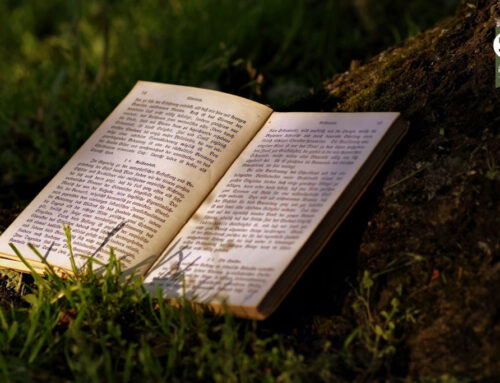Röhrende Rivalen und Brunftgebrüll mit Punktesystem:
Bei Hirschrufwettbewerben imitieren Menschen unterschiedliche Laute des Rothirschs.
Warum eigentlich? Und worauf kommt es an?
HIRSCHRUFEN
Menschen imitieren Laute des Rothirschs
Ein Mann stößt auf einer Bühne seltsame Laute aus, indem er in ein großes Schneckengehäuse hineinkeucht. Daneben hält sich ein anderer mit einem Ochsenhorn bereit. Das Publikum lauscht wie gebannt, und hinter einem Holzverschlag sitzen Jurymitglieder, die sich eifrig Notizen machen. Wo wir sind? Auf einer Hirschrufmeisterschaft. Und eines sei gleich vorausgeschickt: So skurril, wie es auf den ersten Blick wirkt, ist das alles nicht.
Als wäre da ein anderer Hirsch
Eine Hirschrufmeisterschaft ist ein Wettbewerb, in dem es um die Fertigkeiten des Hirschrufens geht. Und zwar nicht von echten Hirschen, sondern von Menschen. Das bedeutet: Wer das Rufen eines Hirsches am besten imitieren kann, gewinnt.
Solche Wettbewerbe gibt es weltweit, vor allem in Europa und den USA. In Österreich findet dieses akustische Kräftemessen alljährlich auf der Messe „Hohe Jagd & Fischerei“ im Messezentrum Salzburg statt. Es erfreut sich sowohl bei Kennern als auch bei Laien großer Beliebtheit. Aber worum geht es dabei genau?


Martin Grasberger, Foto: © Weidwerk, Jakob Wallner
„Das Hirschrufen hat für die Jagd einen ganz konkreten und traditionellen Hintergrund“, erklärt Martin Grasberger, Chefredakteur des Jagd-Fachmagazins „Weidwerk“ und außerdem Jury-Mitglied bei der Hirschrufmeisterschaft in Salzburg. „Es geht unter anderem darum, mit diesen Lauten während der Brunftzeit Hirschen vorzumachen, dass da ein anderer paarungswilliger Hirsch ist. Der Hirschrufer gibt während der Jagd also Laute von sich, die echte Hirsche in der Brunftzeit machen, um ihre Stärke zu zeigen oder Rivalen herauszufordern. Damit fühlt sich der Platzhirsch von einem Rivalen bedroht, er sucht seinen Widersacher, was ihn wiederum zum gewünschten Ort lockt.“
Das Hirschrufen imitiert also meistens männliche Hirsche – und seltener weibliche, weil diese kaum oder nur sehr leise Laute von sich geben. „Es wird aber auch sehr wohl der Mahnruf verlangt“, erklärt Grasberger. „Das ist der Laut des weiblichen Rotwildes, der aber viel weniger brachial klingt als die männlichen Rufe.“ Die Laute der männlichen Hirsche wiederum unterscheiden sich deutlich voneinander – und genau das macht das Hirschrufen so anspruchsvoll.
Eindrücke von der Hirschrufen-EM in Polen 2024
Fotos: © Grasberger
Die Königsdisziplin des Hirschrufens
Es gibt drei Haupttypen von Rufen:
Der Ruf des Platzhirsches ist ein tiefer, langer Laut, mit dem ein dominanter Hirsch sein Revier und seine Stellung im Rudel markiert. Der Suchruf stammt von einem jungen oder unterlegenen Hirsch, der auf der Suche nach brunftigen Tieren ist. Sein Ton klingt meist unsicher und vorsichtig.
Beim Kampfruf handelt es sich um einen aggressiven, herausfordernden Laut, der bei der Begegnung mit Rivalen eingesetzt wird. „Und dann gibt es da noch die, wie ich finde, Königsdisziplin“, sagt Grasberger –
„nämlich das Hirschduell: Dabei muss der Hirschrufer zwei Hirsche, also zwei Kontrahenten, darstellen, die sich um das Brunftrudel streiten. Das heißt: Der eine Hirsch hat das Brunftrudel schon, er ist also der Platzhirsch, der über die temporäre Gruppe von Rottieren während der Paarungszeit wacht. Der andere ist der Herausforderer, der ihm den Titel streitig machen möchte. Meist macht das der Hirschrufer mit zwei unterschiedlichen Rufinstrumenten.“
Hier ist, wie Grasberger betont, nicht nur das Imitieren des Lautes wichtig, sondern die Darstellung einer ganzen Szenerie: „Wenn du als Jurymitglied dann das Gefühl hast, dass du jetzt wirklich im Wald bist und zwei Hirsche verbal aufeinander losgehen, dann hat der Teilnehmer eigentlich schon eine hohe Punktezahl im Sack.“
Österreich als Land der Hirschrufer
In Salzburg qualifizieren sich in der Regel die drei besten Hirschrufer Österreichs für die Europameisterschaft. Diese findet jährlich in einer jeweils anderen Stadt in Europa statt. „Da kann man sich dann wirklich mit den Besten der Besten messen und voneinander lernen“, sagt Grasberger. „Ich würde mir allerdings wünschen, dass es in Österreich mehr regionale Wettbewerbe gibt, wie das in manchen Ländern Osteuropas der Fall ist.
Wir vom Weidwerk bieten auch immer wieder Seminare dazu an, und eines weiß ich deswegen ganz sicher: In Österreich haben wir viele hervorragende Hirschrufer, nur stellt sich halt nicht jeder bei einem Wettbewerb auf die Bühne. Zumindest noch nicht.“
UNSERE
LESE-EMPFEHLUNG
Bildquellen für diesen Beitrag: © Weidwerk, Jakob Wallner | © Grasberger
Autor für diesen Beitrag: L. Palm / Jagdfakten.at
DIESEN
BEITRAG TEILEN